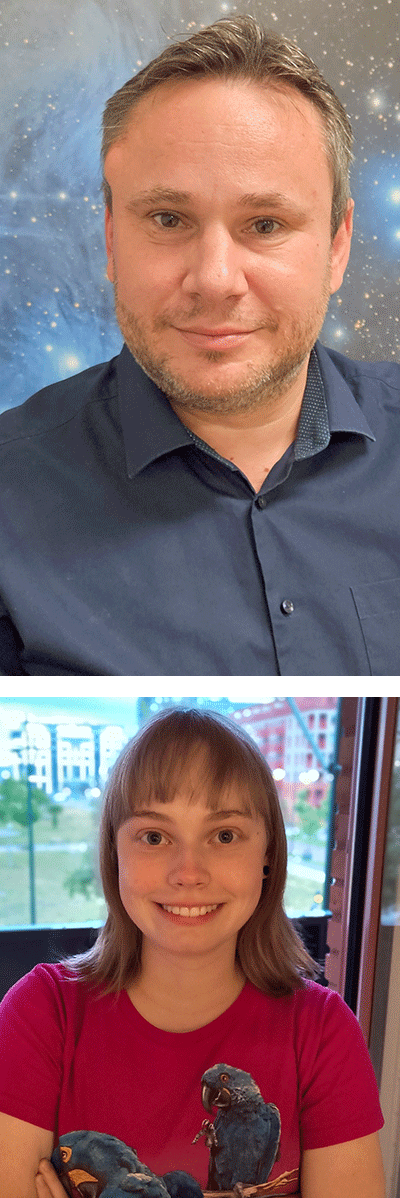 ¹ AGN
¹ AGN
² AGN
Radioastronomie an der Sternwarte Nürnberg
Die seit 2014 bestehende Fachgruppe Radioastronomie der Astronomischen Gesellschaft in der Metropolregion Nürnberg konnte im April 2019 ein 3-m-Radioteleskop auf der Regiomontanus-Sternwarte einweihen. Zu Ehren des Mitentdeckers der kosmischen Hintergrundstrahlung wurde das Teleskop nach Arno Penzias benannt.
Neben der Messung der solaren Radiostrahlung können insbesondere Beobachtungen im Bereich der 21-cm-Strahlung des neutralen Wasserstoffs der Milchstraßenarme mit sehr gutem Erfolg durchgeführt werden.
So ist es bei der Sonnenbeobachtung möglich die Sonnenaktivität und die Zeitgleichung für Nürnberg zu bestimmen.
Bei den Messungen an den Milchstraßenarmen kann die relative Rotationsgeschwindigkeit anhand der Dopplerverschiebung der 21-cm Wasserstofflinie bestimmt und so eine Rotationskurve der Milchstraße erstellt werden.
In diesem Workshop werden zuerst die Grundlagen der Radioastronomie vermittelt. Im Anschluss werden Messungen mit dem Arno-Penzias-Teleskop vorgeführt. Im dritten Teil können die Teilnehmenden am eigenen Laptop mit einem normalen Tabellenkalkulationsprogramm (Excel, OpenOffice Calc, Numbers o.ä.) Messungen zu den oben genannten Themen auswerten.
Zu den Personen
Marco Nelkenbrecher ist Realschullehrer für Mathematik und Physik an der staatlichen Realschule Hilpoltstein.
Seine Leidenschaft für Astronomie lebt er seit 1998 an der Regiomontanus-Sternwarte und dem Planetarium in Nürnberg aus. Zwischen 2005 und 2014 war er im Vorstand der heutigen Astronomischen Gesellschaft in der Metropolregion Nürnberg tätig. Als stellvertretender Leiter des Organisationsteams für Nordbayern betreute er die Aktionen des „Internationales Jahr der Astronomie 2009“ in der Region.
Patricia Oerter ist frischgebackene Abiturientin und angehende Physikstudentin.
Für Astronomie begeistert sie sich schon seit langer Zeit. Ihren ersten Kontakt zum Arno Penzias Teleskop hatte sie während einer langen Nacht der Wissenschaften. Es dauerte nicht lange, bis sie dort eigene Messungen durchführte. Ihre Messergebnisse zum Wasserstoffspektrum der Milchstraße haben unter anderem Eingang in eine Jugend forscht Arbeit und in ihre Seminararbeit gefunden.
 Erlanger SchülerForschungsZentrum
Erlanger SchülerForschungsZentrum
Externe Unterstützung von Schülerprojekten in Forschungscamps
Das Erlanger SchülerForschugnsZentrum ESFZ (www.esfz.nat.fau.de) födert Schülerinnen und Schüler beim Forschen an ihren eigenen Projektideen aus Physik und Technik. Dabei können dies Jugend forscht-Projekte, Projekte im Zusammenhang mit W- oder P-Seminaren sein oder Projekte oder Ambitionen zur Teilnahme an Wettbewerben.
In einwöchigen Forschungscamps am Department Physik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg werden die Jugendlichen durch Tutorinnen und Tutoren aus der Physik fachlich sowie didaktisch-methodisch unterstützt.
Im Workshop wird exemplarisch eine solche Förderung einer Projektidee über mehrere Camps hinweg nachempfunden. Zudem werden allgemein diverse Unterstützungsmöglichkeiten seitens des ESFZ bei der Betreuung von Schülerprojekten
Zur Person
Kosmas Dandl ist seit 2020 Betreuer im Erlanger Schülerforschungszentrum und seit 2023 auch Mitglied im Leitungsteam. An den Forschungscamps des ESFZ hat er schon als Schüler mehrmals teilgenommen und dort auch an erfolgreichen Jugend forscht Projekten gearbeitet.
Kosamas Dandl studiert Physik und Informatik für das Lehramt am Gymnasium und ist während seines Studium schon an vielen Schulen aktiv im Einsatz, so z.B. als Lehrwerker am Willibald-Gluck-Gymnasium in Neumarkt oder als Betreuer im VDI-Schülerforschungszentrum-Richard Willstätter.
Neben seinem Einsatz für Jugend forscht engagiert er sich auch in der Organisation und Jury des German Young Physicists´ Tournament GYPT.
Seine Begeisterung für naturwissenschaftliche und technische Projekte gibt er gerne an Lehrkräfte und Jugendliche weiter.
 Jugend forscht
Jugend forscht
Jugend forscht – MINT-Wettbewerbe für Einsteiger
Jugend forscht ist das größte und bekannteste MINT-Wettbewerbsformat in Deutschland. Alles, was zum Aufbau eines erfolgreichen Jugend forscht-Kurses notwendig ist, wird in diesem Workshop anhand von praktischen Beispielen gezeigt. Angefangen bei Kreativitätstechniken zur Projektfindung, natürlich zum selbst ausprobieren, der Projektbetreuung, über den Jahresverlauf bei Jugend forscht bis hin zur festen Implementierung von MINT-Wettbewerben im Schulprofil werden gezeigt.
Zur Person
Christoph Bürgis ist der Jugend forscht Botschafter von Bayern und Betreuungslehrer für Jugend forscht am Gymnasium Gröbenzell. Dort ist er auch als MINT-Koordinator in der erweiterten Schulleitung tätig. Als Botschafter organisiert und hält er diverse Qualifizierungsangebote für Projektbetreuende und solche, die es werden wollen.
Vor seiner Tätigkeit am Gymnasium Gröbenzell hat er bereits als Jugend forscht Projektbetreuer am Luitpold-Gymnasium München und dem Spessart Gymnasium Alzenau gearbeitet. An der FAU Erlangen-Nürnberg hat er Chemie und Biologie für das Lehramt an Gymnasium studiert.
 M!ND, Würzburg
M!ND, Würzburg
Das Schülerforschungszentrum als Kooperationspartner bei Wissenschaftswoche & Co – Rahmenbedingungen, Konzepte, Ziele
Außerschulische Lern- und Forschungsorte bieten Schülerinnen und Schülern (SuS) experimentelle Möglichkeiten zur Bearbeitung eigener Forschungsfragen. Dabei sind die Ansätze und Fragen der SuS oftmals schulisch motiviert, sie ergeben sich beispielsweise im Kontext von wissenschaftspropädeutischen Seminaren, Projektwochen, etc. Im Workshop soll ausgehend von schulischen Rahmenbedingungen (z. B. Wissenschaftswoche in bayerischen Gymnasien) und den Erfahrungen und Bedarfen der Teilnehmenden ausgelotet werden, wie Schule und außerschulischer Lernort möglichst synergetisch kooperieren können und welche Lernziele bzw. Kompetenzen dabei insbesondere adressiert werden können und sollen.
Der Kurs richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 7. Jahrgangsstufe.
Zur Person
Dr. Markus Elsholz studierte Physik an der FAU Erlangen-Nürnberg, wo er im Anschluss bis als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeitete. 2008 übernahm er die Geschäftsleitung der turmdersinne gGmbH in Nürnberg. Seit 2010 ist Dr. Elsholz Geschäftsführer des Mathematischen, Informatischen und Naturwissenschaftlichen Didaktikzentrums (M!ND) an der Julius-Maximilians-Universität Würzburgwo er 2018 auch promovierte. Er war Vorstandsmitglied des nationalen Netzwerks der Science-Center und Technikmuseen MINTaktiv e.V.. Seit 2020 ist er Sprecher des Würzburger Netzwerks „netzwerkWISSEN“.
 Deutsches Museum, Nürnberg
Deutsches Museum, Nürnberg
Wasserstoff als Energiespeicher der Zukunft
Dieses Laborprogramm bietet einen Einblick in die faszinierende Welt des Wasserstoffs.
Ausgerechnet das leichteste Element des Periodensystems soll in Zukunft eine tragende Säule unserer Energieversorgung werden. Doch welche Herausforderungen sind noch zu überwinden, um Wasserstoff zu einem nachhaltigen Energieträger zu machen?
Der Kurs beginnt, indem die Teilnehmenden eine kleine Menge Wasserstoff herstellen und mit der Knallgasprobe nachweisen. Durch die anschließende Spaltung von Wasser mit Hilfe des elektrischen Stroms wird deutlich, wie wir Wasserstoff als unerschöpflicher Energiespeicher nutzen können. Über das eigene Experimentieren mit einer Brennstoffzelle erleben die Teilnehmenden, wie sich die im Wasserstoff gespeicherte Energie ganz kontrolliert mit einem Elektromotor nutzen lässt.
Während des Programms wird der derzeitige Stand der Wasserstofftechnik erläutert. Im gemeinsamen Diskurs lernen die Teilnehmenden die Nachhaltigkeit von Wasserstoff als Energieträger zu bewerten.
Der Kurs richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 7. Jahrgangsstufe.
Zur Person
Dr. Ronald Göbel studierte Chemie an der Universität Potsdam und promovierte anschließend am Institut für Chemie der Universität Potsdam und dem Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung. Anschließend arbeitete Dr. Göbel as wissenschaftliche Mitarbeiter an der Humboldt-Universität zu Berlin im Exzellenzcluster Bild Wissen Gestaltung im Basisprojekt Gestaltung von Laboren sowie als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Chemie des Deutschen Museums. Seit 2021 leitet Dr. Göbel die Besucherlabore des Deutschen Museums Nürnberg.
 Realschule Manching
Realschule Manching
MINT-Computing mit dem Microbit Einplatinenprozessor
Der micro:bit Einplatinencomputer verfügt über zahlreiche Sensoren, die fest auf seiner Platine verbaut sind. Darüber hinaus sind zusätzliche Sensoren und Aktoren günstig zu bekommen. Somit ist er ein hervorragendes Werkzeug um Messwerte bei Experimenten im Unterricht und in der Projektarbeit aufzunehmen.
In dem Workshop MINT-Computing wollen wir mit der graphischen Entwicklungsumgebung microBlocks einfache Programme erstellen, die diese Sensoren ansteuern und deren Messwerte darstellen. Programmierkenntnisse sind für diesen Workshop nicht nötig.
Zur Person
Martin Loder, ein erfahrener Lehrer für Englisch und Informationstechnologie, bietet einen spannenden Workshop zum Thema MINT-Computing mit dem micro:bit an. In seiner Funktion als Berater digitale Bildung an den Realschulen in Oberbayern-West hat er bereits zahlreiche innovative Projekte initiiert und umgesetzt. Als Autor digitaler Schulbücher, darunter die bekannte Reihe „Fit for IT“ im Verlag Ludwig Schulbuch, bringt er eine Fülle an Fachwissen und didaktischer Erfahrung mit. Sein Workshop zielt darauf ab, wie man Schülerinnen und Schüler für die Grundlagen des Programmierens und des Physical Computing begeistern kann.
 DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Oberpfaffenhofen
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Oberpfaffenhofen
DLR_School_Lab, Oberpfaffenhofen
Schwerelos forschen
Ein wichtiger Teil der Weltraumforschung, wie beispielsweise auf der internationalen Raumstation ISS, befasst sich mit der Frage, wie physikalische, biologische und chemische Prozesse in der Schwerelosigkeit ablaufen. Das soll zum einen helfen, die Raumfahrt noch sicherer und zuverlässiger zu machen. Zum anderen geht es dabei aber auch um ein besseres Verständnis von komplexen Vorgängen, welches dann wiederum in technischen oder medizinischen Anwendungen auf der Erde resultiert.
Im Unterricht hat sich das Thema Schwerelosigkeit für Schülerinnen und Schüler als besonders attraktiv und motivierend erwiesen. Darüber hinaus sind die Inhalte auch aus der Fachperspektive insbesondere für den Physikunterricht von großer Bedeutung. Der Workshop stellt neben fachlichen Hintergründen auch unterrichtspraktische Methoden vor, wie mit einfachen Mitteln Schwerelosigkeitsexperimente durchgeführt werden können.
Zur Person
Dr. Tobias Schüttler studierte Physik und Mathematik für das Lehramt an Gymnasien an der LMU München, wo er 2007 die erste Staatsprüfung absolvierte. Nach dem Referendariat arbeitete er bis 2015 als Studienrat an einem Gymnasium und anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Didaktik der Physik der LMU München. Dort promovierte er 2021 zu Themen des außerschulischen Physiklernens im Raumfahrtkontext. Seit 2019 leitet er das DLR_School_Lab Oberpfaffenhofen, an dessen Aufbau und Entwicklung er maßgeblich mitbeteiligt war. Seine Forschungsinteressen sind das Lernen von Naturwissenschaften in Schülerlaboren und im Raumfahrtkontext sowie Begabtenförderung.
 FAU Erlangen-Nürnberg / Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik (EVT)
FAU Erlangen-Nürnberg / Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik (EVT)
Klimaneutralität oder sichere Stromversorgung? – Wie die Energiewende funktionieren kann
Fridays-for-Future und der Putins Überfall auf die Ukraine machten allen klar: die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern wie Öl, Gas und Kohle muss enden. Doch können Stromversorgung, Wärmeversorgung und der Mobilitätssektor auf klimaneutrale Technologien umgestellt werden, ohne Einschränkungen für Lebensstandard und Versorgungssicherheit hinnehmen zu müssen? Ist Wasserstoff die Lösung? Ein vorsichtiger Blick in die Zukunft macht klar, die Energiewende kann funktionieren – und sie muss funktionieren.
Zur Person
Prof. Karl leitet seit 2011 den Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik der Universität Erlangen-Nürnberg am EnergieCampus Nürnberg (EnCN) und beschäftigte sich bereits zuvor an der TU München und an der TU Graz mit erneuerbaren Energien und dezentralen Energiesystemen. Im Jahr 2007 gründete er mit Kalifornischen und Münchner Investoren das Start-up Unternehmen agnion Inc. das Anfang 2012 von der Wirtschaftswoche und der Strategieberatung Roland Berger als eines der 30 erfolgversprechendsten Greentech-Startups Deutschlands bewertet wurde. Mit den FAU-Strompreisstudien 2015 und 2019 belegte er bundesweite Einsparungen von bislang etwa 70 Milliarden Euro durch die Energiewende.
 LMU München
LMU München
Auswirkungen der Stratosphäre auf Wetter und Klima am Erdboden
Die Stratosphäre ist die Atmosphärenschicht zwischen ca. 15-50 km Höhe und beheimatet die uns schützende Ozonschicht. Obwohl sie nur ca. 15% der Masse der Atmosphäre enthält, trägt sie einen nicht unerheblichen Teil zum Wetter- und Klimageschehen am Erdboden bei. In diesem Vortrag werde ich einen Überblick über den aktuellen Kenntnisstand zu diesen Auswirkungen der Stratosphäre auf Wetter und Klima am Erdboden geben und dabei v.a. auch auf neue Ergebnisse aus unserer eigenen Forschung eingehen.
Zur Person
Nach seinem Physikstudium an der Universität Leipzig arbeitete Thomas Birner als Doktorand am Institut für Physik der Atmosphäre am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen und promovierte 2003 an der LMU München.
Nach PostDoc – Aufenthalten an den Universitäten Reading (England) und Toronto (Kanada) war Thomas Birner Associate Professor an der Colorado State University USA. Seit 2008 ist er Professor für Theoretische Meteorologie an der LMU München
 Zentrum für Telematik, Würzburg
Zentrum für Telematik, Würzburg
Abenteuer Weltall mit Kleinstsatelliten erleben
Die schrecklichen Umstände in der Ukraine und im Iran haben uns gegenwärtig sehr bewusst gemacht, wie wichtig Satellitennetze für einen ungestörten Informationsfluss sind. Die in den letzten Jahren erst aufgebauten Kleinsatellitennetze in niedrigen Erdumlaufbahnen spielen hier eine wichtige Rolle für innovative Anwendungen in Erdbeobachtung und Telekommunikation, die in Zukunft auch unseren Alltag -ähnlich wie heute schon das Navi- prägen werden.
In der Wissenschaft liefern Sensornetze aus Kleinst-Satelliten auch für die Verbesserung von Klimavorhersagen Schlüsselinformation durch verteilte Beobachtungsprinzipien. Bei der gerade am ZfT in Würzburg realisierten „CloudCT“-Mission charakterisieren beispielsweise 10 kooperierende Kleinst-Satelliten durch Computertomographie-Methoden das Innere der Wolken und ermöglichen so verbesserte Klima-Prognosen. Es wird in weiteren Beispielen von gerade in Würzburg realisierten Satelliten das enorm breite Anwendungsspektrum von Kleinsatellitennetzen illustriert, das von der Quantenschlüsselverteilung für abhörsichere Kommunikation bis zur Verfolgung von Aschewolken nach Vulkanausbrüchen reicht.
Zur Person
Klaus Schilling war schon als Schüler an Wissenschaft interessiert und kam bei „Jugend forscht“ dreimal im Landeswettbewerb Bayern auf den 2. Platz, bevor er dann 1976 Bundessieger wurde. Nach dem Studium von Mathematik, Physik und Biologie war er in der Raumfahrtindustrie verantwortlich an der Realisierung interplanetarer Raumsonden (wie HUYGENS zum Saturn-Mond Titan, ROSETTA zur Erforschung der Kometen, Mars Rover MIDD) beteiligt. 2003 wurde er zum Ordinarius für Robotik und Telematik an der Universität Würzburg berufen. Parallel ist er Vorstand des unabhängigen Forschungsinstituts „Zentrum für Telematik“. Aktuelle Forschungsschwerpunkte betreffen Kleinst-Satelliten, sowie fortgeschrittene Automatisierungstechnik und Robotik. Sein Team baute 2005 den ersten deutschen Pico-Satelliten UWE-1 (im Deutschen Museum München ausgestellt). Seine Raumfahrtschwerpunkte liegen bei Formationen von Kleinst-Satelliten zur Erdbeobachtung und bei der Telekommunikation im „Internet of Space“.
Er war als Consulting Professor 2002-2006 an der Stanford University tätig, ist Mitglied in der International Academy of Astronautics (IAA) und erhielt zahlreiche internationale Preise, darunter 2012 den ERC Advanced Grant „NetSat“ , 2018 der ERC Synergy Grant „CloudCT“, 2021 die EugenSänger-Medaille der DGLR, 2023 die Frank-J.-Malina Medal der IAF verliehen. 2022 wurde er mit dem Bayerischen Verfassungsorden ausgezeichnet.
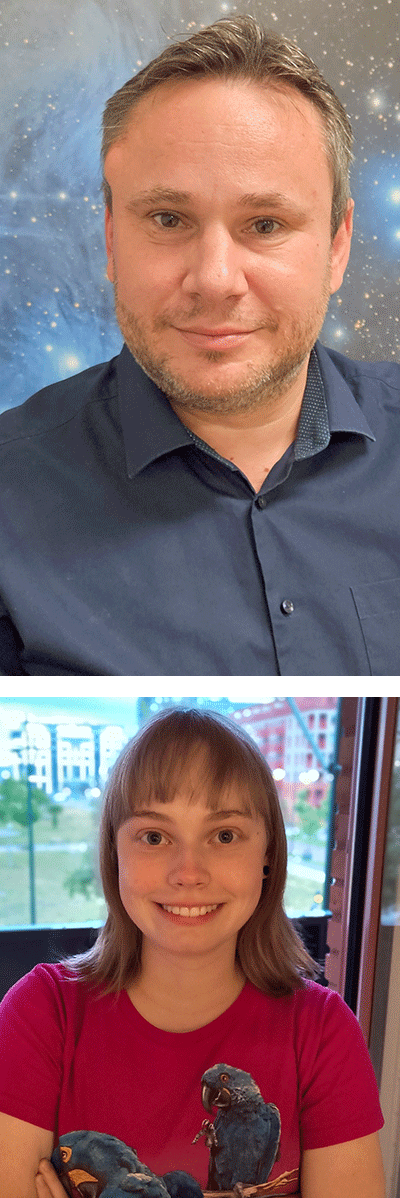 ¹ AGN
¹ AGN


 Erlanger SchülerForschungsZentrum
Erlanger SchülerForschungsZentrum Jugend forscht
Jugend forscht M!ND, Würzburg
M!ND, Würzburg Deutsches Museum, Nürnberg
Deutsches Museum, Nürnberg Realschule Manching
Realschule Manching DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Oberpfaffenhofen
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Oberpfaffenhofen FAU Erlangen-Nürnberg / Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik (EVT)
FAU Erlangen-Nürnberg / Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik (EVT) LMU München
LMU München  Zentrum für Telematik, Würzburg
Zentrum für Telematik, Würzburg