 HIPS – Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland
HIPS – Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland
Vom Wald in die Apotheke – Antibiotika aus Bodenbakterien
Die Bedrohung antimikrobieller Resistenz (AMR) ist eine wachsende globale Gesundheitsbedrohung, die auch als „stille Pandemie“ bezeichnet wird. Sie entsteht durch die natürliche Anpassung von Bakterien an häufig verwendete Wirkstoffe und wird durch den übermäßigen Einsatz von Antibiotika bei Menschen und in der Tierhaltung beschleunigt. Die Konsequenzen dieser Entwicklung sind gravierend: einfache Infektionen werden immer schwerer behandelbar, was zu längeren Behandlungszeiten, höheren Kosten und einer erhöhten Sterblichkeit führt. 2019 starben Studien zufolge bereits 1,2 Millionen Menschen an Infektionen mit resistenten Keimen.
Woher kommen unsere Wirkstoffkandidaten?
Neben den chemischen Ansätzen, bei denen Moleküle von Grund auf synthetisiert und optimiert werden, suchen wir am Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) auch nach neuen Wirkstoffen aus Mikroorganismen. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf räuberischen Bodenbakterien, den sogenannten Myxobakterien. Diese nutzen auf ihrer Jagd nach anderen Mikroorganismen ein Arsenal an chemischen Stoffen, um ihre Beute zu töten und so als Nahrungsquelle zu erschließen. Unser Ziel ist es, diese so genannten mikrobiellen Naturstoffe zu isolieren und als Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer Antibiotika zu nutzen. Da Myxobakterien im Vergleich zu anderen Bakterienarten nur relativ wenig erforscht sind, bieten sie eine besonders hohe Chance bislang unbekannte bioaktive Substanzen zu entdecken.
Forschung an neuen Antiinfektiva
Der wesentliche Forschungsschwerpunkt am Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) ist die Suche nach neuen anti-infektiven Wirkstoffen aus Mikroorganismen und deren Weiterentwicklung für die Anwendung am Menschen. Myxobakterien sind für uns dabei besonders spannende Forschungsobjekte, weil sie im Boden, einem stark umkämpften Lebensraum, leben. Hier müssen Mikroorganismen extrem gut an ihre Umgebung angepasst sein, um sich gegen die zahlreichen Konkurrenten durchsetzen zu können. Dazu produzieren sie eine Vielzahl von bioaktiven Naturstoffen. Hinzu kommt, dass sie als „Räuber des Bodens“ auf ihrer Jagd nach anderen Mikroorganismen ein Arsenal an chemischen Stoffen produzieren und dazu nutzen, ihre Beute zu töten und so als Nahrungsquelle zu erschließen. Unser Ziel ist es, diese mikrobiellen Naturstoffe zu isolieren und als Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer Antibiotika zu nutzen. Da Myxobakterien im Vergleich zu anderen Bakterienarten nur relativ wenig erforscht sind, bieten sie eine besonders hohe Chance bislang unbekannte bioaktive Substanzen zu entdecken.
MICROBELIX – unser Citizen Science Projekt
Im Jahr 2017 initiierten wir mit „Sample‘ das Saarland“ unser erstes Citizen Science Projekt am HIPS, das wir heute unter dem Namen „MICROBELIX“ deutschlandweit weiterführen. Ziel des Projekts ist es, Bürgerinnen und Bürger über die Themen Antibiotika und Antimikrobielle Resistenz zu informieren und gleichzeitig aktiv an unserer Forschung zu beteiligen. Dazu haben wir ein „Probensammel-Kit“ entwickelt, mit dem unsere Citizen Scientists an möglichst biodiversen Stellen Bodenproben nehmen und diese ans Institut zurückschicken. Diese Proben enthalten in praktisch allen Fällen bisher unbekannte Bakterienarten, darunter auch Myxobakterien. Unser interdisziplinäres Forschungsteam isoliert die Bakterien im Labor und analysiert die von ihnen produzierten Substanzen auf ihre bioaktive Wirkung. So konnten wir bereits mehrere bislang unbekannte Naturstoffklassen entdecken, deren Potenzial noch nicht vollständig ausgeschöpft wurde.
Was können Sie in unserem Workshop erwarten?
In unserem Workshop erwartet Sie zunächst eine kurze Einleitung in das Thema Antibiotikaforschung und warum diese eine Sonderstellung im Bereich der Pharmazeutischen Forschung einnimmt. Wir vermitteln Ihnen einen Einblick in die interdisziplinären Forschungsansätze der Antibiotikaforschung am HIPS und geben Impulse, wie Sie diese als Anwendungsbeispiele in Ihren Unterricht implementieren können. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf der Entwicklung von Antibiotika aus mikrobiellen Naturstoffen. Anhand unseres Citizen Science Projektes bieten wir Ihnen und Ihren Schüler und Schülerinnen darüber hinaus die Möglichkeit, sich aktiv an der Wirkstoffforschung des HIPS zu beteiligen.
Über das HIPS
Das Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) in Saarbrücken ist ein Standort des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) und wurde im Jahr 2009 gemeinsam vom HZI und der Universität des Saarlandes gegründet. Die Forschenden am HIPS fokussieren sich auf die Entwicklung neuartiger Antiinfektiva sowie deren Anpassung auf die Anwendung am Menschen. Dazu kombinieren sie modernste medizinische Chemie, naturstoffbasierte Forschung mit innovativen Wirkstofftransport- Ansätzen und Wirkstoffbioinformatik. www.helmholtz-hips.de
Zu den Personen
Dr. Yannic Nonnenmacher ist promovierter Biochemiker und am HIPS für den Bereich wissenschaftliche Strategie verantwortlich.
Dr. Daniel Krug ist promovierter Chemiker, der sich im Laufe seiner Laufbahn auch eine Begeisterung für Mikrobiologie und Bioinformatik entwickelt hat. Seit 2009 ist er Wissenschaftler am HIPS und hat 2017 mit dem MICROBELIX-Vorläufer (Sample‘ das Saarland) sein Herzensprojekt ins Leben gerufen.
Lucia Bernhardt ist Human- und Molekularbiologin. Sie fertigte ihre Masterarbeit am HIPS im Bereich der Mikrobiellen Naturstoffforschung an. Seit Frühjahr 2024 arbeitet sie am HIPS im Bereich Wissenschaftskommunikation und ist weiterhin Teil des MICROBELIXTeams.
 htw saar – Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
htw saar – Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes


 ¹ Universität Bonn
¹ Universität Bonn VDE-Saar
VDE-Saar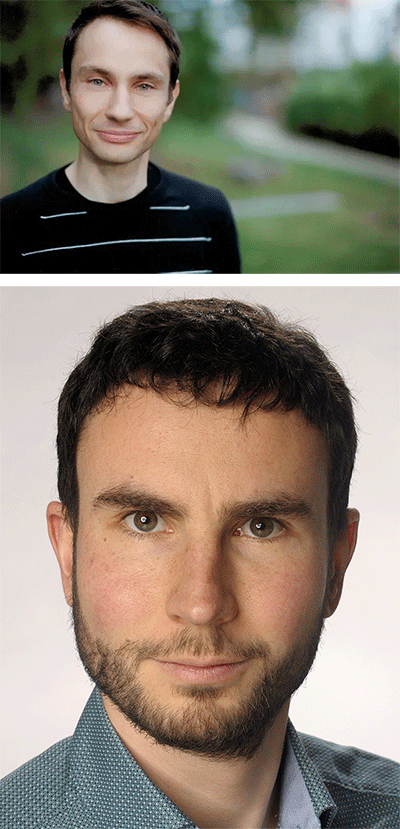 ¹ Fachrichtung Materialwissenschaften, Universität des Saarlandes
¹ Fachrichtung Materialwissenschaften, Universität des Saarlandes HIPS – Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland
HIPS – Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland ¹ Fachrichtung Informatik, InfoLab-Saar, Universität des Saarlandes
¹ Fachrichtung Informatik, InfoLab-Saar, Universität des Saarlandes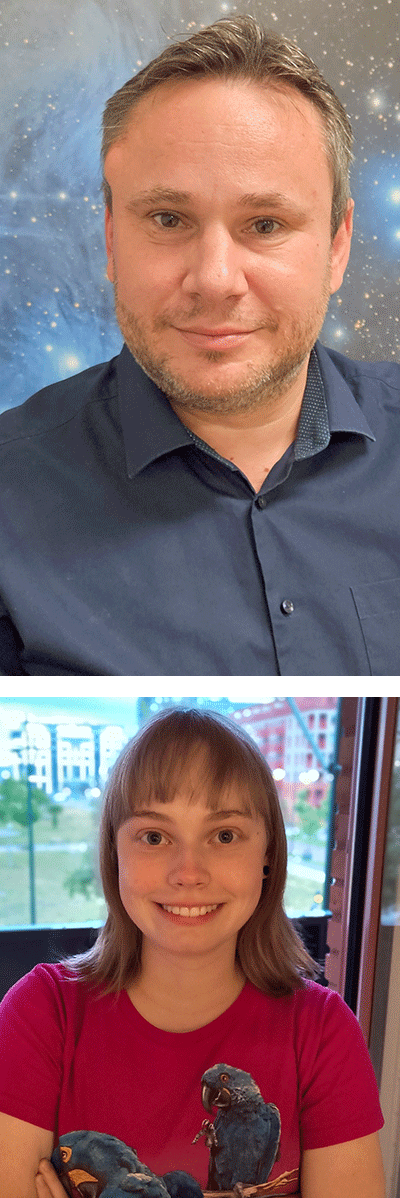 ¹ AGN
¹ AGN Erlanger SchülerForschungsZentrum
Erlanger SchülerForschungsZentrum Jugend forscht
Jugend forscht M!ND, Würzburg
M!ND, Würzburg