
Noch kein Titel
Kein Text …
Zur Person
Prof. Markus J. Buehler ..

Noch kein Titel
Kein Text …
Zur Person
Prof. Markus J. Buehler ..
 Was?
Was?
Wo?
Xenotransplatation: Chance aus dem Organmangel?
Das Problem des Organspendermangels spitzt sich zu: Im Jahr 2024 warteten in Deutschland zum Stichtag 664 Patienten auf ein Spenderherz, es standen jedoch nur 350 Spenderorgane für Transplantationen zur Verfügung. Gleichzeitig verstarben im Jahr 2024 über 600 Personen die auf ein Spenderherz gewartet haben. Die Xenotransplantation, also die Übertragung von tierischen Organen in den Menschen, könnte ein Weg aus diesem Dilemma sein. Ein Ansatz ist die Verpflanzung von Schweineherzen zunächst in Affen und, sollte dies gelingen, letztendlich in Menschen. Problematisch bei der Xenotransplantation sind akute und meist tödliche Abstoßungsreaktionen. Das menschliche Immunsystem bekämpft die übertragenen tierischen Organe, da sich bestimmte Oberflächenproteine im transplantierten Gewebe von denen des Menschen unterscheiden. Die Schweine, deren Herzen für die Verpflanzung genutzt werden sollen, müssen deshalb erst genetisch verändert werden. Dabei werden beispielsweise bestimmte Gene ausgeschaltet, die für die Oberflächenproteine auf den Organen kodieren.
In Tierexperimenten wurden bereits sehr gute Ergebnisse mit diesem Ansatz erreicht: Pavianen mit transplantierten, genetisch veränderten Schweineherzen überlebten, z. T. bis zu sechseinhalb Monaten nach Transplantation in einem Überlebensmodell. Dies gelang durch eine multiple genetische Veränderung der Schweine (Spender) wie auch ein verbessertes Immunsuppression Regime (Empfänger) nach der Transplantation. Die genetischen Modifikationen im Schwein zielen darauf ab, die Immunreaktion in den Pavianen und eine übermäßige Blutgerinnung in den Blutgefäßen des Herzens zu verhindern. Im zweiten Ansatz änderten sie die Prozedur der Organerhaltung. Ein weiterer wichtiger Schritt ist de Präservation der Organe nach Explantation und vor Implantation. In einem neuen Ansatz werden die Schweineherzen nach der Entnahme, nicht wie bislang üblich, einmal mit einer Nährlösung zu behandeln und danach auf Eis zu lagern, sondern mit einer blutbasierten, sauerstoffhaltigen Schutzlösung bei acht Grad Celsius bis zur Implantation perfundiert. Im weiteren Verlauf wurde der Blutdruck der Paviane gesenkt, die Blutgerinnung verhindert und die Zellteilung in den Schweineherzen blockiert. Letzteres ist besonders wichtig, da die Herzen der Schweine andernfalls nach der Transplantation weiterwachsen und für den Brustkorb der Paviane zu groß werden. Außerdem wurden die Paviane einer auf den Menschen übertragbaren Immunsuppression unterzogen und damit die Abstoßungsreaktionen geringgehalten.
Neben dem Herz, welches für das Überleben des Patienten essentiell ist, ist auch die Niere in den letzten Jahren stark in den Fokus für eine Xenotransplantation gerückt. In beiden Organsystemen hat die biomedizinische Forschung große Fortschritte, bis hin zu den ersten Ansätzen im Menschen, gemacht.
Zur Person
Prof. Dr. Rabea Hinkel ist Leiterin der Abteilung Versuchstierkunde am DPZ. Gemeinsam mit ihrem Forschungsteam studiert sie Herzkreislauferkrankungen im Tiermodell, speziell die Herzinsuffizienz, und die Auswirkungen von Risikofaktoren wie Diabetes, Bluthochdruck oder erhöhte Blutfettwerte, um neue Therapien für diese Risikogruppen zu entwickeln. Ein weiterer Fokus ihrer Forschung liegt auf der Xenotransplantation. Ziel der Studien ist die Nutzbarmachung von tierischen Organen, beispielsweise von Schweinen, für den Menschen, um dem weltweiten Organspendermangel zu begegnen. Darüber hinaus forscht Rabea Hinkel schwerpunktmäßig an Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch, um die Belastungen von Versuchstieren zu reduzieren und Versuche zunehmend durch Alternativmethoden zu ersetzen. Rabea Hinkel studierte Veterinärmedizin in Gießen und promovierte 2009 an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) in der Inneren Medizin. Anschließend arbeitete sie als Postdoktorandin und Tierärztin für Versuchstierkunde an der LMU München, bevor sie 2015 in die Innere Medizin des Klinikums rechts der Isar der TU München und an das Institut für Prophylaxe und Epidemiologie der Herzkreislauferkrankungen der LMU wechselte. Seit Juli 2018 ist sie gemeinsame Professorin für Versuchstierkunde an der Stiftung Tierärztlichen Hochschule Hannover und am DPZ.
 Philipps-Universität Marburg
Philipps-Universität Marburg
Neuartige Solarzellen für den Klimaschutz
Absehbar wird Solarenergie die wichtigste Energiequelle für kosteneffizienten Klimaschutz werden. Dieser Vortrag vollzieht zunächst die historische Entwicklung der Photovoltaik nach und diskutiert dann globale Szenarien zum Ausbau der Photovoltaik. Am Beispiel Deutschlands wird gezeigt, mit welchen Strategien sich eine große Anzahl von fluktuierenden Erzeugern in das Stromnetz integrieren lassen. Insbesondere wird gezeigt, wie sich mit www.energy-charts.info verlässliche Daten zu vielen aktuellen energiewirtschaftlichen Fragestellungen beziehen lassen.
Der Ausbau der Photovoltaik im Multi-TW-Maßstab bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich. Hier helfen neuartige Solarzellen wie Tandemsolarzellen und Perowskitsolarzellen in Zukunft insbesondere Ressourcenverbrauch und Energieaufwand in der Herstellung zu senken. Sie besitzen aber wiederum ganz eigene Herausforderungen. Im zweiten Teil des Vortrags wird deshalb ein Einblick in den aktuellen Stand der Forschung gegeben und welche technologischen Entwicklungen für die Zukunft absehbar sind.
Zur Person
Jan Christoph Goldschmidt studierte Physik in Freiburg und Sydney und promovierte 2009 an der Universität Konstanz mit einer Arbeit am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg. Im Zeitraum von 2010 bis 2021 war er Leiter der Gruppe „Neuartige Solarzellenkonzepte“ am Fraunhofer ISE mit den Forschungsschwerpunkten Photonenmanagement und Perowskit-Silizium-Tandemsolarzellen. Im Jahr 2012 war er Gastwissenschaftler am Imperial College in London und 2013 Dahrendorf-Stipendiat am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change in Berlin. Seit 2021 ist er Professor für die Physik der Solar-Energiekonversion an der Philipps-Universität Marburg.
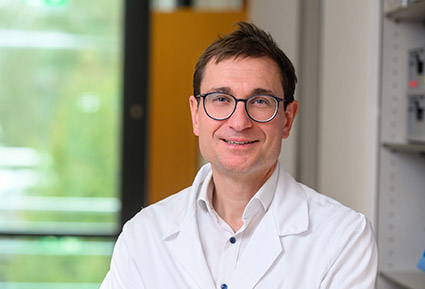 Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie, Marburg
Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie, Marburg
Natürliche Photosynthese und synthetische Biologie. Eine „new-to-nature-Software“ für nachhaltige Kohlenstoffbindung
Um die Klimakrise zu bewältigen, muss der Mensch CO₂-Emissionen reduzieren. Gleichzeitig müssen neue Wege gefunden werden, der Atmosphäre aktiv CO₂ zu entziehen. Das so gewonnene CO₂ nachhaltig zu nutzen, wäre Wertstofferhalt nach dem Vorbild der Natur: Pflanzen binden mit der Photosynthese pro Jahr Milliarden Tonnen CO₂. Trotzdem wird die natürliche Photosynthese nicht ausreichen, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Der Vortrag zeigt die Begrenztheit der biologischen Photosynthese auf und skizziert, wie wir mithilfe synthetischer Biologie eine leistungsfähigere Alternative erschaffen können. Verschiedene Ansätze und Technologiezukünfte von maßgeschneiderten Biokatalysatoren zu modifizierten Algen und Pflanzen bis hin zu künstlichen Chloroplasten werden vorgestellt, und deren Chancen und Risiken diskutiert. Der Vortrag wirft auch einen größeren Blick auf das Feld der synthetischen Biologie, durch die der Mensch aktiver Teil der Evolution wird und neue Lösungen initiieren und realisieren kann, die die natürliche Evolution nicht hervorgebracht hat.
Zur Person
Tobias J. Erb ist synthetischer Biologe und Direktor am Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg, Deutschland. Sein Team arbeitet an der Schnittstelle zwischen Biologie und Chemie und konzentriert sich auf die Entdeckung, Funktion und Entwicklung von CO₂-umwandelnden Enzymen und Stoffwechselwegen. Erb studierte Chemie und Biologie und forschte während seiner Promotion an der Universität Freiburg und der Ohio State University, USA. Nach einem Postdoc-Aufenthalt an der University of Illinois (2009-2011) leitete Erb eine Nachwuchsgruppe an der ETH Zürich (2011-2014), bevor er an das Max-Planck-Institut in Marburg wechselte, wo er 2017 zum Direktor ernannt wurde. Erb erhielt für seine Forschung zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Otto-Bayer-Preis (2018), den Merck Future Insight Award (2022) und den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis (2024). Seit 2023 ist er Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.
 Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK)
Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK)
Gatersleben
Chromosomen in Forschung und Schule
Chromosomen sind Träger der Erbinformation und spielen damit eine zentrale Rolle in der Pflanzenzüchtung. Ihre Zusammensetzung ist entscheidend für die Vererbung von Merkmalen und somit für die Vielfalt von Pflanzenarten und Sorten. In der Züchtung wird die genetische Zusammensetzung eines Organismus verändert, um gewünschte Eigenschaften zu fördern oder neue Sorten zu entwickeln.
Der Vortrag wird die gegenwärtige Forschung und zukünftige Anwendungsfelder der Chromosomenbiologie darstellen. Im Weiteren wird ein Experiment vorgestellt, in dem Schüler experimentell mit der CRISPR/Cas9-Methode und der Organisation von Chromosomen bzw. Genomen im Biologieunterricht vertraut gemacht werden können. Neben der gezielten Manipulation von Genen und Chromosomen können mit Hilfe von CRISPR/Cas9 auch definierte DNA-Sequenzen markiert werden.
Um dieses Experiment zu ermöglichen, wurde der fluoreszenzbasierte CRISPR-Nachweis von DNA durch eine nicht fluoreszenzbasierte Methode ersetzt. Die Detektion spezifischer Sequenzen in Chromosomen und Zellkernen wird unter Verwendung von alkalischer Phosphatase oder Peroxidase und einem Standard-Durchlichtmikroskop möglich gemacht. Diese Nachweismethode kann somit durchgeführt werden, auch wenn kein teures Fluoreszenzmikroskop zur Verfügung steht. Da es sich um ein nicht-transgenes Verfahren handelt, ist für die Durchführung des Experiments kein S1-Sicherheitslabor notwendig.
Zur Person
Andreas Houben wurde am 06.05.1963 in Magdeburg geboren. Er studierte Pflanzenzüchtung in Halle-Wittenberg, wo er 1993 auf dem Gebiet der Chromosomenbiologie promovierte. Von 1993 bis 1995 war er als Postdoktorand am Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung Gatersleben tätig. Von 1996 bis 2001 forschte er erst als DFG-Stipendiat und später als Queen-Elizabeth-II-Fellow an der Universität Adelaide (Australien). Seit 2001 ist er Arbeitsgruppenleiter und seit 2015 Leiter des Bereichs „Chromosomenbiologie“ am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK), Gatersleben. 2005 war er Gastprofessor an der Kyoto-Universität (Japan), habilitierte 2010 und ist seit 2017 apl. Professor an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Seine Forschergruppe entschlüsselt die Regulation, Organisation und Evolution von Chromosomen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollen zur Beschleunigung von Züchtungsprozessen eingesetzt werden.
 Astrophysiker
Astrophysiker
Die ESA-Mission Euclid: Aufbruch ins Dunkle Universum
Materie, wie wir sie kennen und beobachten können, macht gerade einmal 5% des Universums aus: Sterne, Planeten, Gas und Staub. Die restlichen 95% des Universums sind mysteriöse, unsichtbare Substanzen, die wir noch nicht verstehen, und die sich nur durch ihre Wirkung auf Licht und Materie verraten: Dunkle Materie und Dunkle Energie.
Wir kennen noch nicht einmal die Spitze des Eisbergs vom Universum. Genaugenommen nur die Hälfte der Spitze.
Die Euclid-Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA bringt Licht ins dunkle Universum. Euclid wurde 2023 gestartet, beobachtet und vermisst Milliarden von Galaxien und ihre Bewegung, über 10 Milliarden Lichtjahre und ebenso viele Milliarden Jahre kosmischer Geschichte. Ein Team von 3000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erstellt aus diesem gewaltigen Datensatz die große, dynamische Karte unseres Universums durch Raum und Zeit. Die Geschichte der Ausdehnung unseres Universums, der Bildung der Galaxien und ihrer großräumigen Verteilung geben uns neue Einsicht in die Eigenschaften der Dunklen Energie und Dunklen Materie. Die nie dagewesenen Daten werden auch viele andere Bereiche der Astronomie revolutionieren, wie dies zuvor schon die Gaia-Mission der ESA getan hat.
Euclid ist auch das neueste der bahnbrechenden Weltraumteleskope, in einer Reihe mit dem Hubble- und James Webb Teleskop.
Dies ist die Geschichte einer revolutionären, visionären Mission, die sowohl aus der Technik im Weltraum als auch aus einer enormen technischen und menschlichen Komponente auf der Erde besteht. Eine Geschichte kosmischer Dimensionen und einmaliger menschlicher Zusammenarbeit, großer Fragen zum Ursprung und der Zukunft unseres Universums und faszinierender Bilder.
Zur Person
Dr. Kai Noeske, geb. 1973, ist Astrophysiker und arbeitet in der zentralen Kommunikation der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Nach seinem Physikstudium und Promotion in Göttingen war er 11 Jahre lang wissenschaftlich in den USA tätig, an der University of California in Santa Cruz, am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics und als ESA-Astronom für das Hubble-Weltraumteleskop. Seine Forschung zur Entwicklung der Galaxien mit Weltraumteleskopen schließt unter anderem die Entdeckung der Galaxien-Hauptreihe ein. Zurück in Deutschland arbeitete er am Max-Planck-Institut für Astronomie/Haus der Astronomie in Heidelberg, und war als Manager des Science Dome wesentlich am Aufbau des Science Centers experimenta Heilbronn beteiligt. Seit 2020 arbeitet er für die ESA, von 2020 bis 2023 als Leiter der Kommunikation zur Weltraumwissenschaft.
Kai Noeske engagiert sich auch privat in der Verbreitung von Wissenschaft, mit zahlreichen Vorträgen sowie als Gast in Podcasts, TV und Radio. Er ist einer der Autorinnen und Autoren des „Survival Guide Wissenschaft“ für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler.
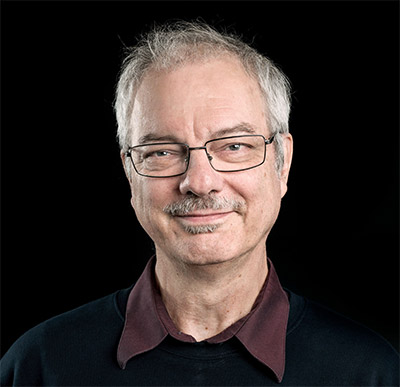 Nobelpreisträger Chemie 2022
Nobelpreisträger Chemie 2022
Universität Kopenhagen
Everything is chemistry
Humans are changing the structure and chemical composition of the world we live in at a historically unprecedented rate. This could have major consequences for all of us now and in the future. It is through chemistry that we can understand the changes that are happening and their consequences. Therefore, we should teach chemistry to our young people because it is through chemistry that we gain the self-understanding of man as an integral part of reality here on Earth. Even our emotions, thoughts and behavior are governed by chemistry, chemistry that has existed for hundreds of millions of years. “Everything is chemistry” will be illustrated with examples and prompts for discussion on how we can modernize our old education system to this all-encompassing concept of scientific empathy. And there’s room for a little “Nobel” chemistry too.
Zur Person
Morten Meldal is a Danish chemist and professor at the Department of Chemistry at the University of Copenhagen, Denmark. He was awarded the 2022 Nobel Prize in Chemistry, alongside Barry Sharpless and Carolyn Bertozzi, for the groundbreaking development of ‘Click chemistry and biorthogonal chemistry’. Throughout Meldal’s career, his research has had innovative influences on methods in peptide and combinatorial chemistry. The methodologies he helped pioneer—solid-phase and combinatorial peptide synthesis, and the CuAAC click reaction—have become standard practices in bioorganic and organic synthesis.

Mensch & KI: Transformer als Transformationstreiber und Gestaltung einer humanen digitalen Zukunft
Künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben. Sie treibt einen tiefgreifenden Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft voran, insbesondere durch leistungsstarke Transformer-Modelle, die Sprache, Daten und Prozesse automatisieren. Aber wie können Unternehmen diese Technologien nutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ohne den Faktor Mensch zu vernachlässigen?
In dieser Präsentation betrachten wir, wie Transformer funktionieren und wie sie sich auf Geschäftsmodelle, Arbeitsprozesse und Entscheidungsfindung auswirken. Die KI-Transformation eröffnet neue Möglichkeiten, stellt Unternehmen und Gesellschaft aber auch vor Herausforderungen: Wie lassen sich Effizienzgewinne und Innovation mit ethischer Verantwortung vereinbaren?
Wir diskutieren Erfolgsstrategien für die Integration von KI, die Rolle des Menschen und Wege zur Gestaltung einer nachhaltigen und menschenwürdigen digitalen Zukunft.
Der Wandel ist unausweichlich – aber es liegt an uns, ihn aktiv und verantwortungsbewusst zu gestalten.
Zur Person
Prof. Dr. Jivka Ovtcharova, Doppelpromotion in Maschinenbau und Informatik, wurde 2003 als erste Professorin der Fakultät für Maschinenbau und Leiterin des Instituts für Informationsmanagement im Ingenieurwesen an das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) berufen. Seit 2004 ist sie zudem die erste Direktorin am Forschungszentrum Informatik (FZI) in Karlsruhe im Bereich Intelligente Systeme und Produktionstechnik. Die gebürtige Bulgarin studierte Maschinenbau und Automatisierungstechnik in Sofia und Moskau und arbeitete an der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, für die Fraunhofer-Gesellschaft und in der Automobilindustrie am inspirierenden Zusammenspiel von Ingenieurwissenschaften und Informatik. Mit ihren Schwerpunkten trägt Prof. Ovtcharova maßgeblich dazu bei, traditionelle Ingenieurarbeit auf Basis moderner Technologien wie Künstliche Intelligenz, Virtuelle Realität, Mensch-Maschine-Interaktionsparadigmen und Digitale Ökosysteme faszinierend und erlebbar zu machen. Prof. Ovtcharova ist Gründerin mehrerer Zentren und Labore am KIT, Senatorin im Senate of Economy Europe, eine der 25 Frauen für die digitale Zukunft in Deutschland, Preisträgerin des ersten Inspiring Fifty DACH Award 2019, „20 Most Inspiring Women Leaders 2023“, national und international geschätzte Expertin, Keynote Speakerin, Autorin und Aufsichtsratsmitglied.
 RPTU Kaiserslautern
RPTU Kaiserslautern
Wenig bekannt, aber allgegenwärtig: Das vielfältige Reich der Pilze
Pilze haben eine lebensspendende und eine bedrohliche Seite: Mit ihren einzigartigen Fähigkeiten und Leistungen, z.B. als Mineralisierte organischer Substanzen in der Natur, als Produzenten wertvoller Wirkstoffe und Medikamente, als Symbionten der meisten Pflanzen auf unserer Erde, bilden sie eine wichtige Grundlage für die Existenz von Leben auf der Erde und damit für und Menschen. Gleichzeitig wirken sie aber auch als gefährliche Krankheitserreger von Pflanzen, Tieren und Menschen.
Zur Person
Matthias Hahn studierte und promovierte an der ETH Zürich (1986) und arbeitete anschließend als Postdoc zunächst an der Stanford Universität (1987–89) sowie an der Universität Konstanz, wo er 1989 habilitiert wurde. Im Jahr 2000 wurde für das Fachgebiet Pflanzen-Pathologie an die Technische Universität Kaiserslautern berufen.

Von kleinen Ideen zu großen Innovationen: BMWs revolutionäres Farbwechsel-Auto – Inspiration für junge Denker
From Small Ideas to Big Innovations: BMW’s Revolutionary Color-Changing Car – Inspiring Young Minds
Stella Clarke hat zusammen mit ihrem Team Automobilgeschichte geschrieben. Clarke hat Konzeptautos entwickelt, die auf Knopfdruck die Farbe wechseln. Dabei übertrug sie die von E-Readern bekannten E-Ink-Technologie, um die Farbe von Fahrzeugaußenseiten zu ändern. So gelingt erstmalig in der Geschichte der Automobilgeschichte eine Maximierung der Produktpersonalisierung.
Damit wird deutlich, dass die Arbeit der Ingenieurin Clarke nicht nur Autos verändert, sondern auch das Verhältnis von Technologie, Kreativität und Kunst.
Es wird deutlich, dass Technologie von Kreativität, Kunst und Design und umgekehrt beeinflusst werden kann. Bekannte Grenzen werden abgebaut und neu gestaltet.
Mithilfe dieses Vortrags erhalten wir auch einen spannenden Einblick in das Forschungsund Technologiezentrum der BMW Group in Garching. Stella Clarke leitet und führt dort ein Team, das die faszinierende Aufgabe hat, eine Idee zu entwerfen, weiterzuentwickeln und zum Produkt zu bringen. Dazu verfügt das Team über mehrere kreative Räume, 3DDrucker, Messgeräte, elektronische Werkzeuge und viele Prototypen.
Zur Person
Stella Clarke studierte Maschinenbau in Australien und in Pennsylvania. In München hat sie an der TUM promoviert. Seit 2007 arbeitet sie bei BMW Group als Entwicklungsingenieurin. Sie brennt für die Naturwissenschaften und steckt sofort jeden mit ihrer Neugier an.