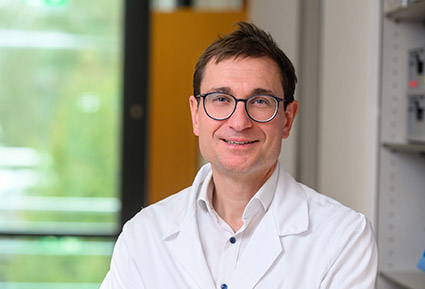 Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie
Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie
Marburg
Natürliche Photosynthese und synthetische Biologie. Eine ‚new-to-nature Software‘ für nachhaltige Kohlenstoffbindung
Um die Klimakrise zu bewältigen, muss der Mensch CO₂-Emissionen reduzieren. Gleichzeitig müssen neue Wege gefunden werden, der Atmosphäre aktiv CO₂ zu entziehen. Das so gewonnene CO₂ nachhaltig zu nutzen, wäre Wertstofferhalt nach dem Vorbild der Natur: Pflanzen binden mit der Photosynthese pro Jahr Milliarden Tonnen CO₂. Trotzdem wird die natürliche Photosynthese nicht ausreichen, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Der Vortrag zeigt die Begrenztheit der biologischen Photosynthese auf und skizziert, wie wir mithilfe synthetischer Biologie eine leistungsfähigere Alternative erschaffen können. Verschiedene Ansätze und Technologiezukünfte von maßgeschneiderten Biokatalysatoren zu modifizierten Algen und Pflanzen bis hin zu künstlichen Chloroplasten werden vorgestellt, und deren Chancen und Risiken diskutiert. Der Vortrag wirft auch einen größeren Blick auf das Feld der synthetischen Biologie, durch die der Mensch aktiver Teil der Evolution wird und neue Lösungen initiieren und realisieren kann, die die natürliche Evolution nicht hervorgebracht hat.
Zur Person
Tobias J. Erb ist synthetischer Biologe und Direktor am Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg, Deutschland. Sein Team arbeitet an der Schnittstelle zwischen Biologie und Chemie und konzentriert sich auf die Entdeckung, Funktion und Entwicklung von CO2-umwandelnden Enzymen und Stoffwechselwegen. Erb studierte Chemie und Biologie und forschte während seine Promotion an der Universität Freiburg und der Ohio State University, USA. Nach einem Postdoc-Aufenthalt an der University of Illinois (2009-2011) leitete Erb eine Nachwuchsgruppe an der ETH Zürich (2011-2014), bevor er an das Max-Planck-Institut in Marburg wechselte, wo er 2017 zum Direktor ernannt wurde. Erb erhielt für seine Forschung zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Otto-Bayer-Preis (2018), den Merck Future Insight Award (2022) und den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis (2024). Seit 2023 ist er Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.


