 ¹ DLR Schoollab Darmstadt
¹ DLR Schoollab Darmstadt
² DLR Schoollab Darmstadt
³ DLR Schoollab Darmstadt
Selbstwirksamkeitserfahrung durch selbständiges Experimentieren
Ziel des Workshops ist es aufzuzeigen, wie durch praktische Erfahrungen die Selbstwirksamkeitserfahrung von Kindern und Jugendlichen durch die Anwendung naturwissenschaftlicher und ingenieurwissenschaftlicher Fragestellungen gestärkt werden kann.
Das zentrale Element des Workshops bilden Experimente aus dem DLR School Lab Darmstadt, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer z.B. in einer Sandbox ihre eigene Landschaft gestalten. Diese Landschaft wird anschließend nach verschiedenen Kriterien auf ihre Besiedelungsfähigkeit geprüft. Dabei kommt moderne Satellitentechnologie zum Einsatz, um den Mehrwert solcher Technologien für die Beobachtung und Analyse von Oberflächen zu verdeutlichen. Durch dieses Hands-On-Experiment erleben die Kinder und Jugendlichen direkt, wie ihre Entscheidungen und Handlungen konkrete Ergebnisse hervorbringen, indem sie ihre selbstgestaltete Landschaft auf Besiedelungsfähigkeit testen und dabei die Auswirkungen ihrer Wahl nachvollziehen können. Ziel ist es, Kindern, Jugendlichen sowie den Lehrenden einen neuen Denkansatz zu eröffnen: Mithilfe von ingenieurswissenschaftlichem Know-How lassen sich die Probleme von heute erkennen und lösen.
Der Workshop zeigt den Teilnehmenden, wie bereichernd der Besuch eines außerschulischen Lernortes und das praktische Erfahren für die Motivation und Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler sein kann. Ziel ist es, Lehrerinnen und Lehrern aufzuzeigen, wie durch Inanspruchnahme externer Angebote Begeisterung, Relevanz und Zugänglichkeit für naturwissenschaftliche und technische Themen geweckt und gestärkt werden kann.
Zur den Personen
Jennifer Bödecker studierte Materialwissenschaften an der Technischen Universität Darmstadt, wo sie nach Ihrem Diplom auch promovierte. Anschließend war sie Projektbearbeiterin im Rahmen eines interdisziplinären Sonderforschungsbereiches (Materialwissenschaft, Maschinenbau, Mathematik) an der Technischen Universität Darmstadt. Danach wechselte Sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in das Institut für Werkstoffkunde (2015 – 1016) und in das MechCenter (2016 – 1019) Seit 2019 ist Jennifer Bödecker Studienkoordinatorin am MechCenter und übernahm 2024 die Leitung des DLR-School_Lab Darmstadt.
Dr. Ute Brinkmann ist seit Mai 2024 Leiterin des DLR_School-Labs an der TU Darmstadt. Nach Ihrem Studium und Promotion in Biophysikalischer und Physikalischer Chemie sammelte sie erste Berufserfahrungen als Wissenschaftliche Angestellte an der Universität Bielefeld sowie als Manager Produktentwicklung bei Johnson und Johnson GmbH. Nach ihrer Elternzeit führten Auslandsaufenthalte mit der Familie sie nach Milwaukee WI, Stockholm und Boston MA, wo sie an verschiedenen Schulen ehrenamtlichen Tätigkeiten nachging, darunter auch an der German International School of Boston. Von 2018 bis 2024 war Frau Dr. Brinkmann Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Darmstadt im Fachbereich Chemie / Fachdidaktik der Chemie.
Seit über 15 Jahren ist Elena Dröge in verschiedenen Funktionen und Positionen im Bereich der Wissenschafts- und Technologiekommunikation tätig: von der Politik über unterschiedliche Forschungsinstitutionen und Universitäten, Unternehmen bis Agenturen. Als Sozialwissenschaftlerin ist es ihr in ihrer aktuellen Tätigkeit als Referentin für Wissenschaftskommunikation und Marketing im Fachbereich Maschinenbau an der TU Darmstadt wichtig, komplexe Themen auf verständliche und persönliche Weise zu vermitteln, damit wissenschaftliche Erkenntnisse in der Gesellschaft wirksam werden können.
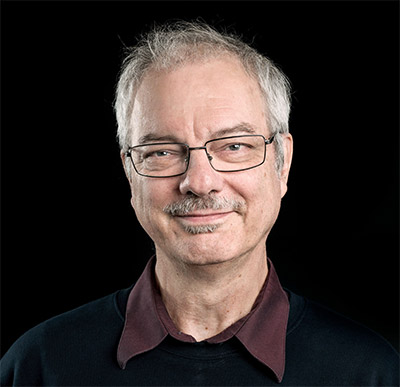 Nobelpreisträger Chemie 2022
Nobelpreisträger Chemie 2022


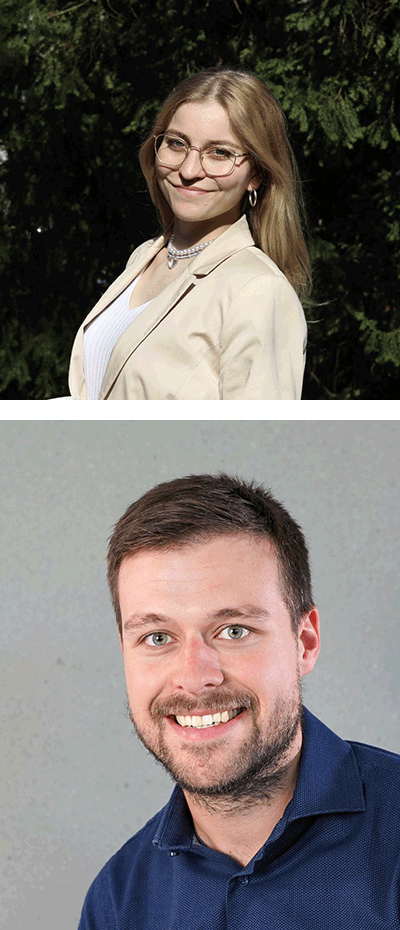 ¹ Justus-Liebig-Universität Gießen – Fachbereich 07 (Mathematik und Informatik, Physik, Geographie)
¹ Justus-Liebig-Universität Gießen – Fachbereich 07 (Mathematik und Informatik, Physik, Geographie) Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Der QR-Code führt ebenfalls zur Downloadseite von phyphox.
Der QR-Code führt ebenfalls zur Downloadseite von phyphox.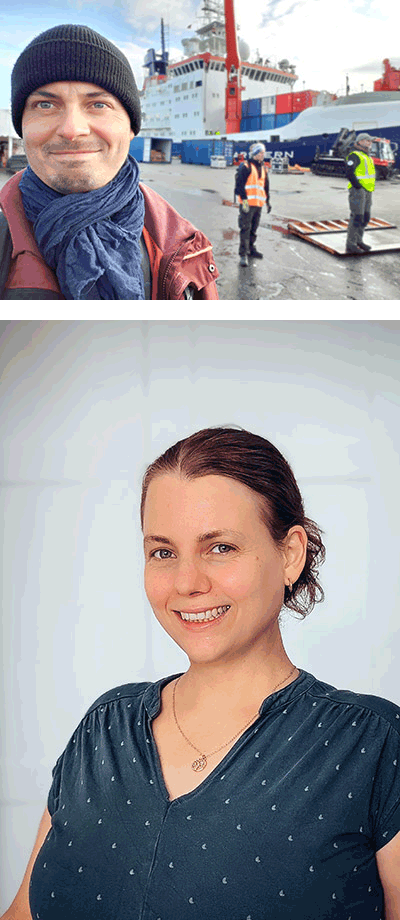 ¹ Herder-Gymnasium Berlin
¹ Herder-Gymnasium Berlin Schloß-Gymnasium, Düsseldorf-Benrath
Schloß-Gymnasium, Düsseldorf-Benrath

































 Max-Planck Institut für Hirnforschung, Frankfurt
Max-Planck Institut für Hirnforschung, Frankfurt ¹ DLR Schoollab Darmstadt
¹ DLR Schoollab Darmstadt Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Pädagogische Hochschule Karlsruhe